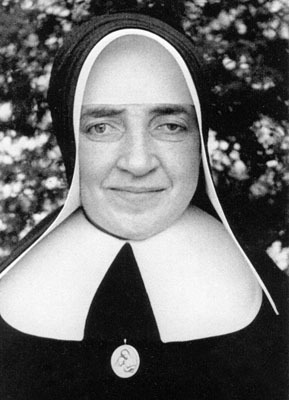Pflege - Patientenrecht
& Gesundheitswesen
www.wernerschell.de
Forum (Beiträge ab 2021)
Archiviertes Forum
Patientenrecht
Sozialmedizin - Telemedizin
Publikationen
Links
Datenschutz
Impressum
Pro Pflege-Selbsthilfenetzwerk
>> Aktivitäten im Überblick! <<

und die Pflege von Kriegsgefangenen und Fremdarbeitern
|
|
Kindheit und Jugend
Emma Üffing, die spätere Ordensschwester Euthymia Üffing, wurde am 8.
April 1914 in Halverde, heute Kreis Steinfurt, als Kind von August Üffing
(1869-1932) und seiner Ehefrau Maria, geb. Schmitt (1878-1975) geboren. Die
Eltern arbeiteten als Landwirte auf ihrem eigenen Hof. Mit 18 Monaten erkrankte
Emma an Rachitis. Ihre Entwicklung verzögerte sich und die Folgen der Krankheit
begleiteten sie ihr ganzes Leben: körperlich blieb sie schwächlich, litt unter
Gehschwierigkeiten, ihr linkes Augenlid hing etwas herunter, sie erreichte eine
Körperlänge von 1,56 m.
Trotz ihrer Entwicklungsverzögerung arbeitete Sie auf dem Bauernhof und wenn
andere ihr eine Arbeit abnehmen wollten, antwortete sie: "Dat kann ick
wuoll!" (Das kann ich wohl). Zu Ihrer eisernen Willenskraft trat schon
früh eine außergewöhnliche Frömmigkeit. Mit 17 Jahren äußerte sie erstmals
den Wunsch Ordensschwester zu werden.
Zeit des Wartens
Der Weg ins Kloster verlief allerdings nicht ohne Hindernisse. Emma arbeite
zunächst als Hauswirtschaftslehrling im Sankt Anna-Krankenhaus in Hopsten. Die
schwere Lungenerkrankung des Vaters zwang Emma, ihre Zeit in Hopsten zu
unterbrechen, um ihren Vater zu pflegen. Nach dem Tode des Vaters kehrte sie
wieder in das Sankt Anna-Krankenhaus zurück. In diesem Krankenhaus arbeiteten
Clemensschwestern, und die Vorsteherin, Euthymia Linnenkemper, wurde Vorbild
für Emma. Am 26. Februar 1934 betete Emma am Sterbebett von Schwester Euthymia
und etwa 4 Wochen später verfaßte sie einen Brief an das Mutterhaus der
Clemensschwestern und bat um Aufnahme in das Kloster. Die Genossenschaft der
Barmherzigen Schwestern von der Allerseligsten Jungfrau und Schmerzhaften Mutter
Maria, so der offizielle Name der Clemensschwestern, war 1808 von Clemens August
von Droste zu Vischering gegründet worden, um Kranke in ihren Wohnungen zu
pflegen. 1934 umfaßte die Gemeinschaft 2638 Mitglieder. Emmas Wunsch, in die
Gemeinschaft aufgenommen zu werden, wurde zunächst nicht entsprochen. Die
damalige Generaloberin lehnte das junge Mädchen wegen des kränklichen
Eindrucks ab. Emma gab jedoch nicht auf. Ein ärztliches Attest und gute
Zeugnisse führten doch noch zu einer Zusage.
Klösterliche Zeit
Am 23. Juli 1934 öffnete sich die Klosterpforte und Emma wurde aufgenommen.
Acht Wochen später erhielt Sie den von ihr gewünschten Namen: Euthymia. Obwohl
das Klosterleben kein "Zuckerschlecken" war: 5 Uhr Aufstehen, Gebet
und Meditation, 6 Uhr Besuch der Heiligen Messe, 6.45 Uhr Frühstück und danach
ununterbrochene Arbeitszeit, nur von einer kleinen Gebetszeit
unterbrochen, zeigen die Briefe an ihre Mutter eine tiefe Zufriedenheit, ja
Glückseligkeit.
Kurze Zeit nach ihrer Einkleidung nahm sie an der staatlichen Prüfung zur
Desinfektorin teil und begann anschließend die Ausbildung zur Krankenschwester.
Am 11. Oktober 1936 legte sie die Gelübde der Armut, der Ehelosigkeit und es
Gehorsams ab, 19 Tage später erfolgte ihre Versetzung in das Sankt Vinzenz-Krankenhaus nach Dinslaken. Hier arbeitete sie zunächst auf der Frauenstation,
ein Jahr später begann sie den Dienst auf der sogenannten Isolierstation Sankt
Barbara. Am 21.9.1939 bestand Schwester Euthymia die Krankenpflegeprüfung mit
der Note: Sehr gut.
Pflege der Kriegsgefangenen
Im Februar 1943 erhielt die Leitung des Sankt Vinzenz-Krankenhauses den
Befehl, die Bettenzahl der Sankt Barbara-Baracke zu erhöhen und kranke
Kriegsgefangene und Fremdarbeiter aus dem naheliegenden Lager in Walsum
aufzunehmen. Schwester Euthymia pflegte nun Franzosen, Belgier, Holländer,
Italiener, Russen, Ukrainer und Polen mit Infektionskrankheiten wie: Krätze,
Gesichtsrose, Tuberkulose, Typhus und Geschlechtskrankheiten. Ohne Rücksicht
auf die dauernde Überbelegung wurden die Kranken manchmal wie Bauschutt vor die
Baracke gekippt. Die Angst vor den Deutschen in den Augen, unterernährt, die
Kleidung zerlumpt und voller Ungeziefer lagen sie auf der Erde. Schwester
Euthymia wusch Sie, versorgte sie mit sauberen Kleidern, legte frische Verbände
an und fand immer noch einen Schlafplatz.
In der Sankt Barbara-Baracke herrschte ein anderer Ton als im Lager. Ein
französischer Kriegsgefangener schrieb: „Dort im Vinzenz-Hospital gab es
keine SS noch SA mehr, sondern wahre christliche Nächstenliebe. Dort wurde ich
wieder als menschliches Wesen behandelt und mit Güte. Ich danke der Schwester
Euthymia, die sehr gut war." (Mussinghoff 2000)
Stiller Widerstand
Schwester Euthymia entsprach nicht dem Typus der Braunen Schwestern und
pflegte, ohne die nationalsozialistischen Vorschriften zu beachten. Sie
unterschied nicht nach Rasse, Nationalität und Religion, alle Kranken sollten
angemessene Hilfe erhalten. Als ihr eigener Bruder von Russen getötet wurde,
ließ sie ihren russischen Patienten keine schlechtere Pflege zukommen.
Mehrmals mußte sie sich vor den nationalsozialistischen Inspekteuren
verantworten. Eine Rüge erhielt sie, weil sie trotz des Verbotes Kranke mit dem
Lift transportiert hatte. Seit diesem Vorfall trug sie die Patienten die Treppen
hinauf.
Für die allgemeine Bevölkerung waren die Nahrungsmittel sehr rar und für
die ausländischen Kranken gab es noch weniger Lebensmittel. Die Rationen
durften nicht verbessert werden. Schwester Euthymia schaffte es dennoch,
Nahrungsmittel zu erbetteln und sie vor den Spionen in sauberen Abfallbehältern
verschwinden lassen. Aus diesem Versteck konnten die Fremdarbeiter unbemerkt die
Brote entnehmen.
Verbandstoffe, Salben, Jodtinkturen, Sulfonamide und Betäubungsmittel
fehlten ebenfalls. Ein Hilfspfleger, der französische Pfarrer Emile Eche
(1903-1965), „hamsterte und organisierte", was die Ordensschwester
stillschweigend duldete.
Die humane Behandlung des „Feindes" wurde bekannt und viele
Fremdarbeiter kamen ins Krankenhaus, um Hilfe zu erhalten. Der Lagerführer des
Ausländerlagers in Dinslaken zweifelte an der Pflegebedürftigkeit der
Gefangenen. In einem Brief an seine Vorgesetzten machte er eine Meldung über
die auffallend hohe Zahl von Fremdarbeitern. Schwester Euthymia mußte sich
langen Verhören unterziehen und Spitzel sollten sie beobachten. Angst vor den
Nazis hatte sie jedoch nicht.
Für die Vermittlung und Einschleusung des Geistlichen Heinrich Theisselmann
(1882-1969) hätte sie bei Entdeckung die Todesstrafe erhalten. Sie schaffte es
immer wieder mittels eines geheimen Codewortes, diese Besuche zu arrangieren, um
den Gefangenen auch geistlichen Beistand zu ermöglichen.
Ihr Leben riskierte sie auch während der Bombardierungen. Nach dem Transport
der Kranken in den Luftschutzkeller lief sie immer wieder zurück, um bei den
nichttransportfähigen Kranken und Sterbenden in den Zimmern zu bleiben;
"keiner der vielen Kranken der Baracke starb, dem die Ordensschwester nicht
beigestanden hätte" (Meyer, 1988).
Kurz vor dem Ende des Krieges wurde das Sankt Vinzenz-Krankenhaus von einem
Bombenhagel zerstört. Schwester Euthymia half bei der Verlegung der Kranken.
Während der Kriegswirren wurde sie mehrmals verschüttet, sie gab niemals auf.
Die Kriegsgefangenen und Fremdarbeiter nannten sie: Engel von Sankt Barbara.
Neue Aufgaben und Faszination bis Heute
Nach der Errichtung des Hilfskrankenhauses versetzte die Generaloberin
Schwester Euthymia, die ihren Beruf sehr liebte, in die Waschküche des Sankt
Vinzenz-Krankenhauses, und ab Januar 1948 übertrug sie ihr die Leitung der
Wäscherei des Mutterhauses und der Sankt Raphaels Klinik in Münster.
Am 9. September 1955 erlag Schwester Euthymia einem Krebsleiden. Seit diesem
Tage erfolgte eine große Verehrung dieser zu Lebzeiten eher unscheinbaren
Schwester. Viele Menschen waren und sind fasziniert von dieser vorbildlichen
Krankenschwester und tief religiösen Frau. Im Mutterhaus der Clemensschwestern
gingen bisher über 150.000 Briefe ein, die von der Verehrung Schwester
Euthymias zeugen. Am 29. Oktober 1959 wurde der Seligsprechungsprozess
eröffnet, er konnte am 1. Juli 2000 erfolgreich abgeschlossen werden. Die
feierliche Seligsprechung wird am 7. Oktober 2001 in Rom stattfinden.
Literaturhinweise
Eche, Emile: Ich diente und mein Lohn ist Frieden. Die Clemensschwester Maria
Euthymia in den Erinnerungen des Kriegsgefangenen Soldatenpriesters Emile Eche,
Münster, 1994
Füsser, Ulrich: Engel der Zwangsarbeiter. Schwester Maria Euthymia pflegte
Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter, in Krankendienst 74 (2001) 1, Seite 13
Loy, Johannes u.a.: Schwester Euthymia „Alles für den großen Gott",
Münster, 2000
Meyer, Wendelin: Schwester Maria Euthymia, Münster, 1988
Mussinghoff, Heinrich: Schwester M. Euthymia (1914 - 1955), Ein verborgenes
Leben für Gott und die Menschen, Kevelaer, 2000
Padberg, Magdalena: M. Euthymia, Clemensschwester, Recklinghausen, 1977
Artikel Ungerechte Kränkung, Münsterisches Bistumsblatt, Februar, 1935
Quellen aus dem Archiv des Mutterhauses der Clemensschwestern, Münster
Bildquelle
Mutterhaus der Clemensschwestern Münster
Autor:
Ulrich Füsser
Regina-Protmann-Schule
am Sankt Katharinen-Krankenhaus
Seckbacher Landstr. 65
60389 Frankfurt